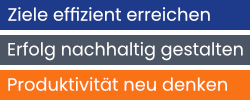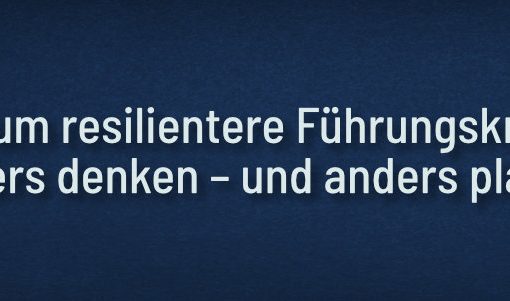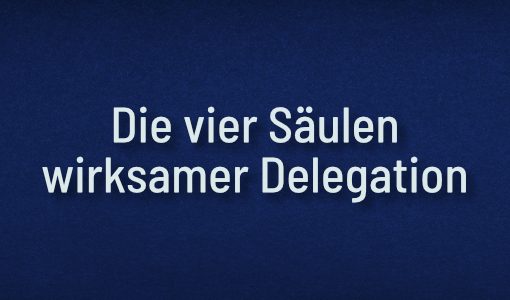Die Gleichung „Digitalisierung = Fortschritt“ geht nicht immer auf.
Zu oft habe ich im Laufe der Jahre erlebt, wie Unternehmen versuchten, ihre eher suboptimalen Prozesse einfach 1:1 zu digitalisieren – mit dem Ergebnis, dass die gleichen Probleme nun in digitaler Form und schneller als bisher auftraten. Besonders fatal: die digitalisierten Prozesse waren nun in Software gegossen und damit deutlich unflexibler als vorher.
Stell dir vor, man justiert eine Produktionsmaschine nicht optimal ein und erhöht dann die Geschwindigkeit. Was kommt dabei raus? Keine besseren Teile, sondern nur schneller produzierter Ausschuss – und durch die höhere Taktung wird es noch schwieriger, korrigierend einzugreifen.
Digitalisierung und der Einsatz von KI verstärken immer das, was bereits da ist – wie eine Lupe, die nicht nur die schönen Details vergrößert, sondern auch die hässlichen kleinen Fehler. Sind Prozesse von Beginn an suboptimal, werden die Probleme durch Digitalisierung nur gravierender, teurer und schwieriger zu beheben. Sind sie hingegen solide, kann die Digitalisierung wie ein Schwungrad wirken.
Viele Unternehmen sehen Digitalisierung immer noch als Wunderwaffe, die wie von Zauberhand organisatorische Probleme und Engpässe löst. Oft wird vorschnell nach Tools gesucht, bevor überhaupt klar ist, was genau verbessert werden soll. Dabei wird oft übersehen, wie oft im bisherigen Prozess manuelle Eingriffe und Korrekturen notwendig sind, weil nicht alles sauber definiert ist. Ist der Prozess dann digitalisiert, fehlt genau diese Flexibilität.
Oft sind den Entscheidern die Schwachstellen in den bestehenden Prozessen nicht einmal bewusst, weil sie sich vor dem Start des Digitalisierungsprojekts nie die Zeit genommen haben, den Prozess in Ruhe mit den Leuten im Unternehmen durchzusprechen, die ihn seit Jahren durch ihr implizites Fachwissen, korrigierende Eingriffe und kompetente Improvisation am Laufen gehalten haben.
Mein Rat ist daher: Nimm dir zuerst Zeit, um Prozessklarheit zu schaffen.
Setze dich mit den Mitarbeitern zusammen, die den Prozess aus der Praxis kennen, und kläre die Fragen:
- „Warum machen wir das überhaupt?“
Gibt es noch eine klare betriebliche Notwendigkeit für diesen Prozess – oder ist er historisch gewachsen, aber heute nicht mehr sinnvoll? - „Was soll am Ende idealerweise dabei herauskommen?“
Welches konkrete Ergebnis soll der Prozess zuverlässig liefern – und wie messen wir, ob das gelingt? - „Wo sind derzeit die größten Schwachstellen oder Engpässe?“
An welchen Stellen hakt es regelmäßig, sind manuelle Eingriffe erforderlich oder entstehen unnötige Reibungsverluste? - „Welche impliziten Regeln, Annahmen oder Improvisationen halten den Prozess derzeit am Laufen?“
Gibt es Wissen oder Routinen, die nur in den Köpfen erfahrener Mitarbeiter stecken – und die in einer Softwarelösung fehlen würden? - „Wie müsste ein idealer Prozess aussehen, wenn wir heute bei null starten würden?“
Was wäre ein sauberes, schlankes Sollkonzept – unabhängig von der aktuellen IT-Struktur oder gewachsenen Gewohnheiten?
Erst wenn du klare Antworten auf diese Fragen hast, macht es Sinn, über die passende technische Umsetzung nachzudenken.